![csm Kachel HVG BTHH cc64c2478e]() Vollakademisierung vs. Teilakademisierung der Therapieberufe: Podiumsdiskussion mit der Bundespolitik am 24. Juni 2022 – Teilnahme online möglich!
Vollakademisierung vs. Teilakademisierung der Therapieberufe: Podiumsdiskussion mit der Bundespolitik am 24. Juni 2022 – Teilnahme online möglich!
Am 24. Juni 2022 veranstaltet der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe (HVG) in Kooperation mit dem Bündnis Therapieberufe an die Hochschulen eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen aus der Bundespolitik. Unter dem Titel "Vollakademisierung versus Teilakademisierung" geht es unter anderem um eine optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie.
Hochkarätig besetztes Podium diskutiert über die Zukunft der Therapieberufe
Von 9 bis 12 Uhr sprechen die Teilnehmenden des Podiums konkret über die Modernisierung der Ausbildungen in den Therapieberufen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie.
Mit dabei auf dem Podium sind:
-
Bettina Müller, MdB (SPD)
-
Saskia Weishaupt, MdB (Bündnis 90/Die Grünen)
-
Nicole Westig. MdB (FDP)
-
Emmi Zeulner, MdB (CDU/CSU)
-
Andreas Pust (VAST, VLL)
Mit dabei außerdem als Expertinnen und Experten:
-
Prof. Dr. Uta Gaidys (Mitglied des Wissenschaftsrats)
-
Prof. Dr. Stefan Herzig (Hochschulrektorenkonferenz)
-
Alexander Stirner (Studierendennetzwerk HochschuleJetzt!)
-
Prof. Dr. Bernhard Borgetto (Vorsitzender HVG-Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe, Sprecher Bündnis Therapieberufe an die Hochschulen)
-
André Laqua (Vorsitzender des Aphasie Landesverbands Berlin e.V.)
Unter der Moderation von Martin von Berswordt-Wallrabe werden im Rahmen dieser Podiumsdiskussion in drei Stunden alle Facetten der Modernisierung der Ausbildungen in den Therapieberufen aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet – aus Sicht der Politik, der Berufsangehörigen, des Wissenschaftsrates, der Hochschulrektorenkonferenz sowie aus Sicht der Patientinnen und Patienten.
Weichen stellen für die Zukunft der Therapieberufe
Der Hochschulverbund Gesundheitsberufe bringt mit dieser Podiumsdiskussion, die in Kooperation mit dem Bündnis Therapieberufe an die Hochschulen stattfindet, wichtige Entscheiderinnen und Entscheider zusammen. Denn: Die Modernisierung der Ausbildungen in den Therapieberufen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie ist längst überfällig und steht auf der Agenda der Bundesregierung. Dabei gilt es, jetzt die Weichen für eine moderne und an den Versorgungsbedarfen orientierte therapeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten zu stellen.
"Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion und hoffen, dass von dieser Veranstaltung ein richtungsweisendes Signal an die Bundesregierung und die Regierungen in den Bundesländern ausgeht", unterstreicht Ursula Cüppers-Böhle, Geschäftsführerin von PHYSIO-DEUTSCHLAND, den Stellenwert dieser Podiumsdiskussion zum aktuellen Zeitpunkt.
Knapp 12.000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat die aktuell laufende Petition „Therapieberufe reformieren – für die Lebensqualität von morgen!“ bereits. Diese bundesweite Unterstützung für eine Vollakademisierung der Therapieberufe Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie unterstreicht den politischen Handlungsbedarf. Fokus dabei sollte aus Sicht von PHYSIO-DEUTSCHLAND die therapeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten von morgen sein.
Jetzt anmelden und am 24. Juni online dabei sein
Die Veranstaltung findet in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Bremer Landesvertretung in Berlin statt. Da es eine Hybridveranstaltung ist, ist eine kostenfreie Teilnahme auch online möglich. Eine Anmeldung ist dafür aber erforderlich.


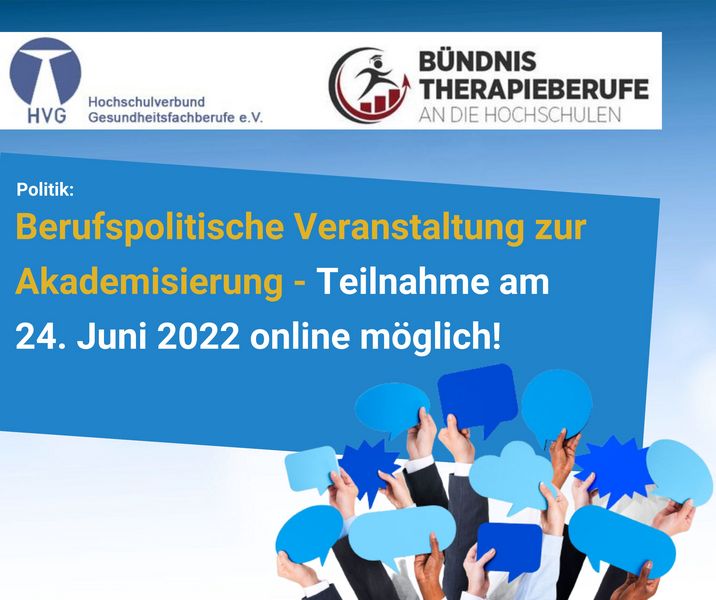 Vollakademisierung vs. Teilakademisierung der Therapieberufe: Podiumsdiskussion mit der Bundespolitik am 24. Juni 2022 – Teilnahme online möglich!
Vollakademisierung vs. Teilakademisierung der Therapieberufe: Podiumsdiskussion mit der Bundespolitik am 24. Juni 2022 – Teilnahme online möglich! Bildung in den Gesundheitsberufen braucht Begegnungen: Programm-Vorschau der Lernwelten 2022 veröffentlicht
Bildung in den Gesundheitsberufen braucht Begegnungen: Programm-Vorschau der Lernwelten 2022 veröffentlicht Krise und Kreativität: Nie waren die Herausforderungen für angehende Pflegende größer
Krise und Kreativität: Nie waren die Herausforderungen für angehende Pflegende größer