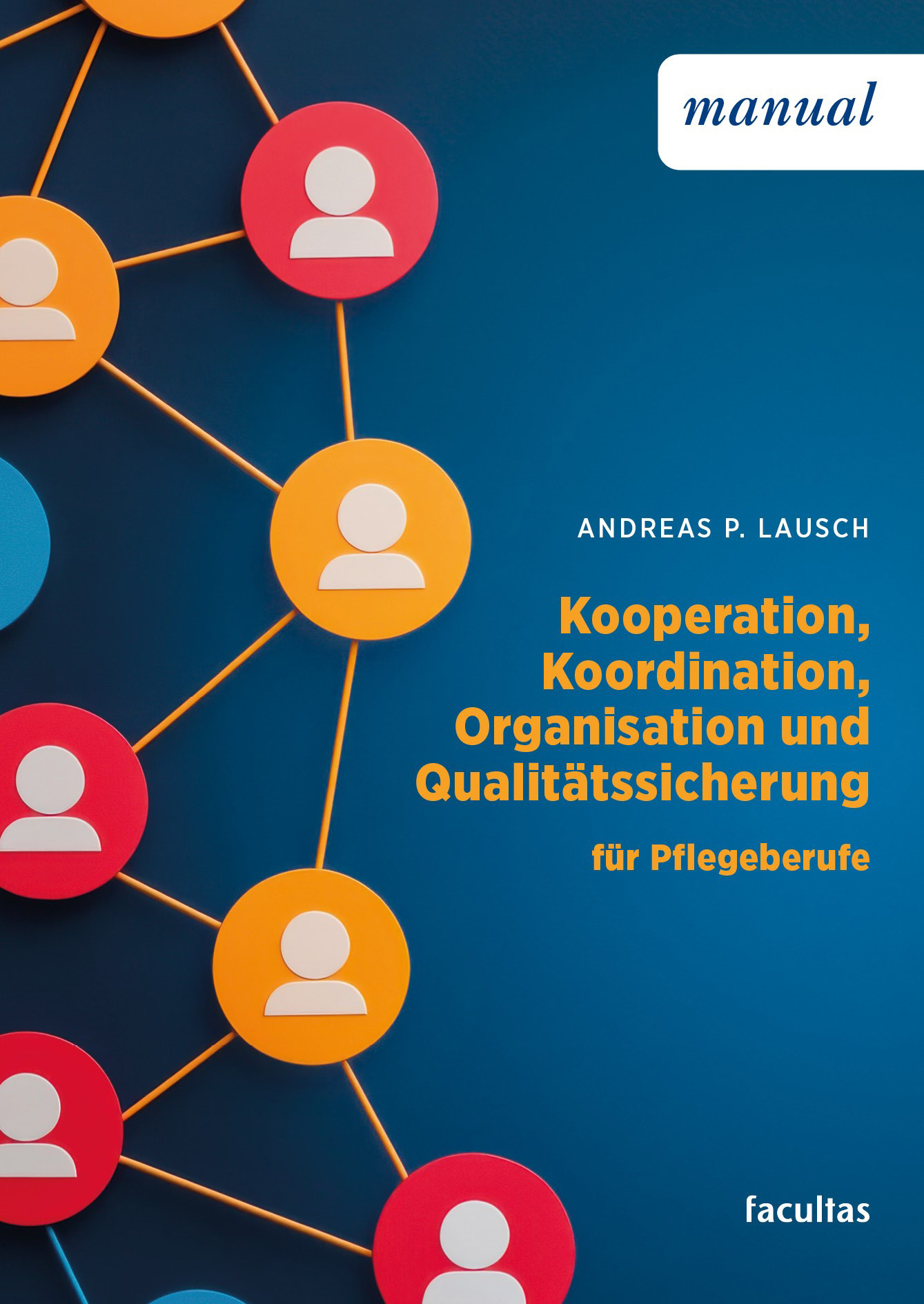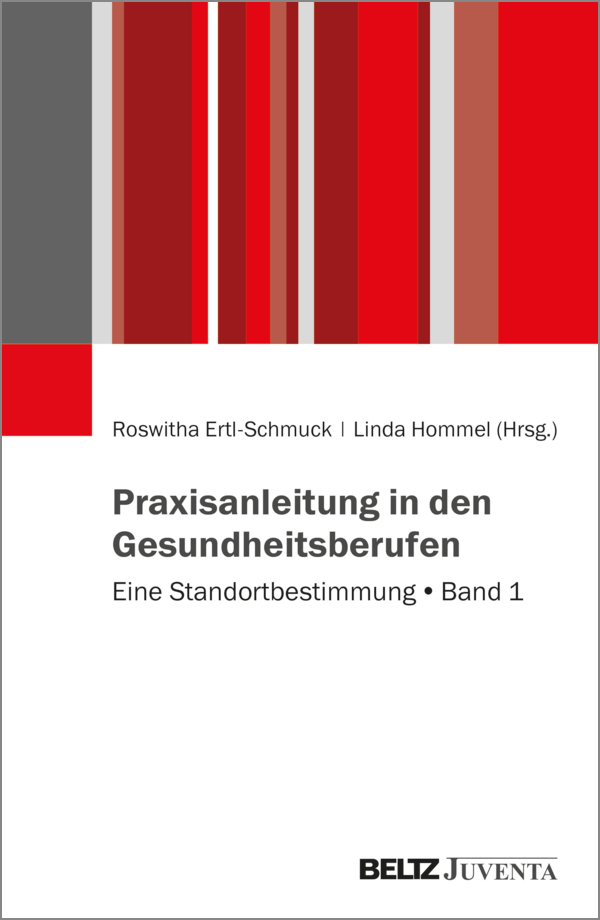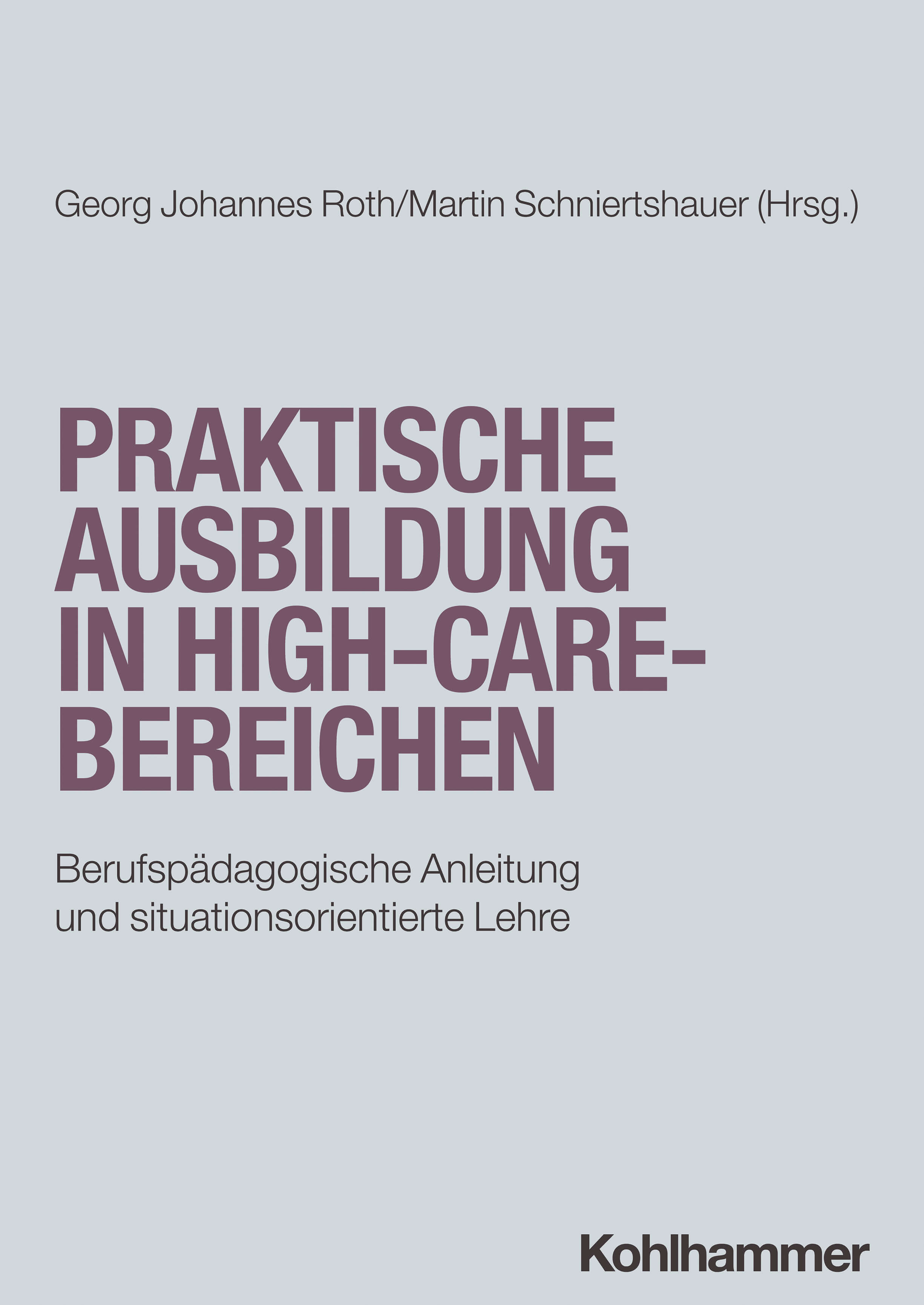 Georg Johannes Roth, Martin Schniertshauer (Hrsg.)
Georg Johannes Roth, Martin Schniertshauer (Hrsg.)
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1. Auflage 2026, 244 Seiten, 39,00 €, ISBN 978-3-17-042857-7
Wie gelingt professionelle Ausbildung dort, wo jede Minute zählt und kleine Fehler gravierende Folgen haben können? Der neue Sammelband von Georg Johannes Roth und Martin Schniertshauer widmet sich einem Thema, das in der pflegepädagogischen Literatur bislang oft nur am Rande behandelt wurde: der systematischen Gestaltung praktischer Ausbildung in Intensivpflege, Notaufnahme, OP, Anästhesie, Palliativpflege und Psychiatrie.
Die beiden Herausgeber bringen dafür ideale Voraussetzungen mit. Georg Johannes Roth (B.A., MBA) ist Pflegepädagoge und Pflegeexperte für Intensivpflege am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales Chur. Er verfügt über langjährige Erfahrung als klinischer Pflegelehrer und Praxisanleiter und ist Lehrbeauftragter an der Ostschweizer Fachhochschule St. Gallen. Martin Schniertshauer (M.Sc.) verbindet als Psychologe, Fachpflegekraft für Intensivpflege und Anästhesie sowie Notfallsanitäter klinische Praxis mit psychologischer Expertise zu Entscheidungsverhalten unter Stress. Das Werk entstand aus der langjährigen Lehr- und Praxiserfahrung beider Herausgeber und vereint Beiträge verschiedener Fachautoren, darunter Prof. Dr. Jörg Wendorff für die pädagogischen Grundlagen.
Der Band ist klar strukturiert: Nach grundlegenden Kapiteln zu Lernen, Didaktik, Kompetenzentwicklung und Digitalisierung folgen Ausführungen zur Praxisanleitung und entwicklungsorientierter Bildung. Den Kern bilden feldspezifische Beiträge zu den einzelnen High-Care-Bereichen, die jeweils typische Lernsituationen und didaktische Herausforderungen aufzeigen. Ergänzt wird dies durch methodische Kapitel zu Simulation, problembasiertem Lernen, Virtual Reality, Clinical Assessment und Cognitive Apprenticeship. Den Abschluss bilden Beiträge zu organisationalen Entwicklungsaspekten und zur persönlichen Haltung von Ausbildungsverantwortlichen.
Was macht dieses Buch besonders? Die zentrale Stärke liegt in der konsequenten Situationsorientierung. Statt abstrakter pädagogischer Konzepte arbeitet der Band mit realistischen Handlungsszenarien aus der Praxis. Ausbildung wird nicht als lineare Wissensvermittlung verstanden, sondern als dynamischer Kompetenzaufbau unter Bedingungen von Zeitdruck, Unsicherheit und emotionaler Beanspruchung. Diese Nähe zur tatsächlichen Praxis unterscheidet das Werk deutlich von allgemeinpädagogischen Standardwerken wie den Bänden von Mamerow oder Quernheim, die sich primär an die generalistische Pflegeausbildung richten.
Besonders gelungen sind die feldspezifischen Kapitel. Sie vermeiden didaktische Abstraktion und zeigen stattdessen konkret auf, welche spezifischen Kompetenzen in der Notaufnahme, auf der Intensivstation oder im OP entwickelt werden müssen. Die Beiträge stammen von Autorinnen und Autoren, die selbst an der Schnittstelle von klinischer Fachpraxis, pädagogischer Qualifikation und Entwicklungsfunktionen arbeiten. Das merkt man: Die Sprache ist präzise, die Beispiele authentisch, die Ratschläge umsetzbar.
Auch methodisch bietet der Band wertvolle Impulse. Neuere Ansätze wie Virtual Reality oder Cognitive Apprenticeship werden nicht als Selbstzweck präsentiert, sondern funktional in didaktische Zielsetzungen integriert. Fallbeispiele, strukturierte Planungshilfen und methodische Arrangements ermöglichen eine unmittelbare Übertragung in die Praxis, ohne in schematische Rezeptlogik zu verfallen. Das Buch versteht Ausbildung konsequent systemisch – eingebettet in organisationale Rahmenbedingungen, Qualifikationsstrukturen und technologische Entwicklungen.
Allerdings hat der Band auch Schwächen. Die theoretische Tiefenschärfe variiert zwischen den einzelnen Beiträgen erheblich. Während die Grundlagenkapitel ihre Argumentation klar in bestehende berufspädagogische Diskurse einbetten, arbeiten mehrere feldspezifische Beiträge – etwa zu Notaufnahme, Palliativpflege und Psychiatrie – stärker beschreibend (siehe Seiten 87-142). Die didaktischen Ableitungen bleiben hier teilweise implizit, was den unmittelbaren Praxisnutzen erhöht, zugleich jedoch die analytische Tiefe begrenzt.
Die empirische Fundierung bleibt insgesamt zurückhaltend. Positive Effekte von Simulation und digitalen Lernsettings werden vor allem über Praxisbeispiele und Plausibilitätsargumente illustriert. Eine systematischere Einbindung empirischer Wirkungsnachweise hätte die wissenschaftliche Überzeugungskraft gestärkt. Auch eine vertiefte Diskussion von Implementationsgrenzen – etwa zu Ressourcenbindung oder Skalierbarkeit – wäre wünschenswert gewesen (Seiten 163-189).
Die thematische Breite führt stellenweise zu Wiederholungen zentraler Leitbegriffe wie Kompetenzorientierung, Reflexion oder Simulation. Für die selektive Nutzung einzelner Kapitel ist dies hilfreich, im fortlaufenden Lesen kann es jedoch ermüden. Zudem fokussieren die Best-Practice-Darstellungen überwiegend auf gelingende Beispiele. Eine stärkere Berücksichtigung von Umsetzungshemmnissen oder weniger erfolgreichen Entwicklungsverläufen hätte zusätzliche Lernpotenziale eröffnet.
Die grafische Gestaltung ist funktional, aber schlicht. Übersichten und Tabellen unterstützen das Verständnis, bleiben jedoch in der visuellen Aufbereitung eher zurückhaltend. Ein ausführlicheres Stichwortregister hätte die Nutzung als Nachschlagewerk erleichtert.
Inhaltlich ist der Band auf aktuellem Stand und berücksichtigt die Anforderungen der generalistischen Pflegeausbildung. Im Vergleich zu anderen aktuellen Werken der Praxisanleitung wie Sahmel (2022) oder Oelke/Meyer (2023) bietet er eine spezifische Fokussierung auf High-Care-Bereiche, die im deutschsprachigen Raum bislang fehlte. Sein eigentlicher Beitrag liegt weniger in theoretischer Innovation als in einer professionellen Übersetzungsleistung: Bekannte pädagogische Prinzipien werden systematisch in hochkomplexe Versorgungskontexte transferiert.
Für wen ist dieses Buch geeignet? In erster Linie profitieren Praxisanleitende, Ausbildungsbeauftragte und Pflegepädagoginnen und -pädagogen, die Ausbildung in spezialisierten Settings konzeptionell weiterentwickeln möchten. Auch Leitungs- und Entwicklungsfunktionen im Gesundheitswesen sowie fortgeschrittene Studierende mit pädagogischem Schwerpunkt finden hier wertvolle Impulse. Weniger geeignet ist das Werk für Leserinnen und Leser ohne pädagogische Vorerfahrung oder für diejenigen, die primär empirische Forschung erwarten.
Zusammengefasst: Der Band ist keine theoretische Innovation, sondern eine fachlich solide Konsolidierung und Professionalisierung eines anspruchsvollen Praxisfeldes. Seine Stärke liegt in der kohärenten Verbindung von pädagogischer Fundierung, realistischer Praxisnähe und systemischer Perspektive. Als Arbeits- und Orientierungsbuch für die Weiterentwicklung praktischer Ausbildung in High-Care-Bereichen ist die Publikation klar empfehlenswert.
Eine Rezension von Michaela Key, MSc,
RN Leiterin Bildung Universitätsspital Zürich, Direktion Pflege und MTTB