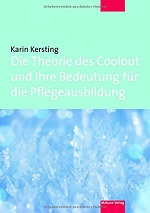
Kersting, Karin
Die Theorie des Coolout und ihre Bedeutung für die Pflegeausbildung
Mabuse, Frankfurt, 2016, 301 S., 39,95 €, ISBN 978-3-86321-285-8
Die Theorie des Coolout und ihre Bedeutung für die Pflegeausbildung
Mabuse, Frankfurt, 2016, 301 S., 39,95 €, ISBN 978-3-86321-285-8
Karin Kersting ist Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe, Diplom-Pädagogin und Professorin für Pflegewissenschaft/Pflegeforschung im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen an der Hochschule in Ludwigshafen am Rhein. Sie leitet den Studiengang Pflegepädagogik und forscht seit 20 Jahren zum Thema „Coolout“ in der Pflege. Die Ergebnisse ihrer ersten Studie: Berufsbildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat sie 2002 im Verlag Hans Huber veröffentlicht; sie waren Teil ihrer Dissertation. Folgestudien sind ab 2007 entstanden und wurden auf die Erforschung der Anforderungen und Widersprüche in Bezug auf die Reaktionsmuster von Praxisanleitern und Pflegepädagogen ausgeweitet.
In der vorliegenden Monographie sind sowohl Erkenntnisse aus den ersten Coolout-Studien, als auch aus den Folgestudien, die ab 2007 entstanden sind, erläutert. Insgesamt hat Karin Kersting 10 Folgeuntersuchungen zum Thema Coolout durchgeführt. Daran waren auch Bachelorstudierende des Studiengangs Pflegepädagogik an der Hochschule Ludwigshafen maßgeblich beteiligt.
Im Vorwort und in der Einleitung beschreibt Karin Kersting die Konfliktsituationen und moralische Dilemmata in der Pflege, die durch ungenügende, strukturelle Bedingungen entstehen. Sie skizziert die Ergebnisse ihrer ersten Studien und begründet die Fortführung und Ausweitung der Coolout-Studien auf Praxisanleiter und Pflegepädagogen. Im ersten Kapitel zeigt sie Zusammenhänge zwischen normativem Handeln und deren Spannungsfeldern auf und setzt diese in den Bezug zu den durchgeführten Untersuchungen.
Im Kapitel zwei werden die Ergebnisse der Coolout-Studien für die Praxisanleiter dargestellt. Die Analyse und Kritik der Konzepte von B. Mensdorf (2010) und C. Olbrich (2009) fließen in die Diskussion um Reaktionsmuster ein. Im Kapitel drei werden „unauflösbare Widersprüche“ in den Arbeitsfeldern der Pflegepädagogen durch Studien zum Coolout erläutert. Das Kapitel endet mit einer kritischen Betrachtung von Wittnebens‘ Pflegelernfelddidaktik und deren bildungstheoretischen Berechtigung im Zuge von „Coolout“- förderlichen Faktoren. Im Kapitel vier fasst die Autorin die Erkenntnisse aus den Studien und Analysen zusammen und zieht daraus Konsequenzen. Überlegungen zur Vermittlung der Erkenntnisse aus den Studien in den Pflegeausbildungen z.B. durch Unterrichtskonzepte bilden den Abschluss des Kapitels.
Karin Kersting bezieht sich in ihrem neuen Buch auf die Ergebnisse ihrer ersten Coolout-Studie, die in Anlehnung an Adornons „Bürgerliche Kälte“ auf die „Kältemechanismen“ der Pflegenden übertragen wird. In den Folgestudien, die auch Praxisanleiter und Pflegepädagogien einbeziehen, schildert sie den Prozess der moralischen Desensibilisierung und der Reaktionsmuster, die dazu führen, dass Berufsangehörige der Pflege sich „kalt“ machen.
Durch die Prüfung von Konzepten der Praxisanleitung, wie sie von Mensdorf (2010) und Olbrich (2009) beschrieben werden, stellt Karin Kersting fest, dass diese dem hohen Anspruch einer idealen Pflege mit den vorhandenen Rahmenbedingungen ebenfalls nicht gerecht werden und keine Antworten auf die strukturell bedingte „Kälte“ geben. Als besonders eklatant arbeitet sie heraus, dass solche Konzepte den Blick für „kälteerzeugende“ Strukturen einengen und sogar „unterlaufen“ und damit eine negative Wirkung erzeugen.
Im vorletzten Teil ihres Buches prüft und analysiert Kersting die kritisch-konstruktive Pflegelernfelddidaktik von K. Wittneben vor dem Hintergrund der Coolout-Studien und „der Idealisierung falscher Praxis“. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die äußeren Umstände, unter denen Pflege tagtäglich stattfindet, aus pflegedidaktischer Sicht nicht berücksichtigt sind. An deren Stelle tritt die Förderung von kommunikativ-reflexiven Fähigkeiten, die die Verständigung zwischen Patient und Pflegenden optimieren soll. Die so verstandene Patientenorientierung verkehrt sich nach Kersting ins Gegenteil, da das pflegerische Handeln sich nicht an der pflegerischen Wirklichkeit orientiert.
Im letzten Teil ihres Buches verdeutlicht Karin Kersting, wie die Erkenntnisse aus dem Coolout-Studien in künftige Pflegeausbildungen integriert werden können. Sie stellt theoretische Unterrichtskonzepte von Bachelorstudierenden vor, die forschend in den Cooloutstudien tätig waren.
Karin Kersting führt den Leser durch eine kurze und prägnante Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse in die aktuelle Thematik ein. Sie erläutert und begründet fundiert die Fortführung und Erweiterung der Coolout-Studien auf die Berufsgruppe der Praxisanleiter und Pflegepädagogen. Als Neuerung werden pflegedidaktische Konzepte der praktischen Anleitung und fachdidaktische Ansätze in Bezug auf „kälteerzeugende Mechanismen“ untersucht. Es gelingt ihr sehr gut, klassische Verfahren und Konzepte der Pflegeausbildung auf ihre Berechtigung im Zusammenhang auf „Kälte“ verursachende Effekte kritisch zu hinterfragen.
Der Nutzen dieser Publikation bezieht sich auf die klare Offenlegung von hinderlichen Rahmenbedingungen für eine ideale Pflege und deren Auswirkungen. Die zusammenfassende Darstellung der Coolout-Studien ist sehr gut gelungen. Der Mehrwert dieser Publikation liegt in der mehrperspektivischen Sicht auf „Kälte“ verursachende Strukturen und auf die Dimensionen von „Kälte“, die auch in konzeptioneller Hinsicht vorhanden sind und in theoretischen Ansätzen identifiziert wurden. Damit sind weitere Forschungslücken geschlossen worden. Karin Kersting gelingt es durch einen klaren Aufbau bei gleichzeitiger Nutzung anschaulicher Graphiken, die Inhalte sehr gut zu verdeutlichen.
Das Thema ist unter Beachtung der anhaltenden schwierigen Rahmenbedingungen, die in der Pflege vorliegen, nach wie vor sehr aktuell. Die Bewusstmachung der „falschen Praxis“ hinterlässt beim Leser teilweise Unbehagen über die ausweglose und schockierende Situation. Die Autorin räumt dem Bewusstwerden des Phänomens „Kälte“ und der Resensibilisierung der beteiligten Akteure einen hohen Stellenwert ein. Damit skizziert sie Lösungsansätze, die auch bereits in der Ausbildung konzeptionell relevant werden können. Im Vergleich zur ersten Publikation hat die Autorin das Thema um wesentliche Aspekte
erweitert.
erweitert.
Eine Rezension von Bettina Glunde

