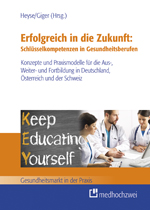
Heyse, V. und M.Giger (Hrsg.)
Erfolgreich in die Zukunft
Schlüsselkompetenzen in Gesundheitsberufen. Konzepte und Praxismodelle für die Aus- Weiter- und Fortbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz
medhochzwei, Heidelberg, 2015, 655 S., € 79,99, ISBN 978-3-86216-184-3
Erfolgreich in die Zukunft
Schlüsselkompetenzen in Gesundheitsberufen. Konzepte und Praxismodelle für die Aus- Weiter- und Fortbildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz
medhochzwei, Heidelberg, 2015, 655 S., € 79,99, ISBN 978-3-86216-184-3
Das umfangreiche Nachschlagewerk steht unter der Programmatik „Keep Educating Yourself“ und versteht die Beiträge als Best Practice Beispiel sowie als strategische Überlegungen zu einer „patientenorientierten, nachhaltigen Entwicklung von Schlüsselkompetenzen der Gesundheitsfachpersonen“ (S.IX). Alle Beispiele stammen aus den deutschsprachigen Ländern Schweiz, Österreich sowie der Bundesrepublik. Mit der Präsentation der vielfältigen Beispiele, insgesamt 29, soll ein breiter Erfahrungstransfer initiiert und notwenige Reformbemühungen in der Aus- und Weiterbildung angeregt werden. Die Identifikation und Förderung sog. Schlüsselkompetenzen sind dabei die Ausgangsbasis aber auch der Zielpunkt um diese Prozesseeinzuleiten und nachhaltig weiterzu entwickeln. Bezugspunkte sind für die meisten der Autorinnen und Autoren der Kompetenzatlas sowie die Kompetenzmodelle und -definitionen von Heyse und den jeweiligen Koautoren (2007,2010, 2012,2014).
Im Zentrum stehen die hochschulischen Qualifikationen für die drei großenBereiche der Therapie- und Pflegeberufe sowie der Medizin.Durch die Vorgabe eines Fragenkataloges an die Autoren und Autorinnen ist eine strukturelle Vergleichbarkeit der Einzelbeiträge gesichert.
Die vorliegende Publikation gliedert sich in drei Teile:
Die vorliegende Publikation gliedert sich in drei Teile:
- Teil I - Zukünftige Versorgungsmodelle/Entwicklungstrends im Gesundheitswesen mit fünf Beiträgen
- Teil II - Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in Gesundheitsberufen, hier die Bereiche der Humanmedizin mit vierBeiträgen, ergänzt um die Psychiatrie, Psychotherapie und Psychologie mit zwei Beiträgen und mit einem Beitrag zur Pharmazie. Es gibt vier Beiträge zu den Therapieberufen und sechs Beiträge zu den Pflegeberufen, dazu die Hebammen/Entbindungshelfer mit zwei Beiträgen.
- Teil III thematisiert in fünf Beiträgen laterale Kooperationen im Rahmen der Versorgungskette.
Teil I
Bei den zukünftigen Versorgungsmodellen stehen zum einen der selbstbestimmte Patient im Zentrum, zum anderen die personalisierte Medizin.
Im ersten Beitrag erfolgt neben der Begriffsbestimmung Schlüsselkompetenz eine Auseinandersetzung mit den normativ gesetzten Systematiken des Europäischen (EQR) und des deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). Aus den Deskriptoren werden methodisch gelenkt die sog, Schlüsselqualifikationen für die Gesundheitsberufe herausgearbeitet und diese wiederum der Systematik des Kompetenzatlasses (Heyse/Erpenbeck/Ortmann 2010) zugeordnet. Am Beispiel zukünftiger Herausforderungen für die Humanmedizin wird dieser Ansatz ausgeformt.Die personalisierte Medizin, so der Autor, verändert auch die Anforderungen an die Kompetenzen der Gesundheitsfachberufe wobei hervorzuheben ist, dass Interprofessionalität im Handeln und in der Bildung als zentral herausgestellt wird.Die bildungspolitischen Herausforderungen werden am Wandel ausgewählter Berufsbilder vor dem Hintergrund der Gesundheitsreformen in Österreich sowie im internationalen Kontext, herausgearbeitet und zwar mit ihren Schwierigkeiten aber auch Möglichkeiten. In der Entwicklung von Fallkompetenzen steht im Zentrum die Biografie sensible Problemlösungsfähigkeit. Der Begründungszusammenhang leitet sich ab aus der alltäglichen Herausforderung die lebensweltlichen und biographischen Bezüge der einzelnen Patienten mit den institutionellen Anforderungen sowie den professionsspezifischen Handlungskonzepten in Einklang zu bringen. Der Beitrag zeigt Wege auf wie diese Problemlösungsfähigkeit erlernt werden kann und zwar in der Wechselwirkung zwischen der Problemhoheit des Individuums und der interaktionellen und institutionellen Deutung.Im letzten Beitrag dieses ersten Teils geht es um Patientensicherheit als interdisziplinäre Aufgabe. Dieser Beitrag setzt sich auseinander mit interdisziplinär einzusetzende Instrumente und Ausbildungskonzepte am Beispiel eines zweisemestrigen Universitätslehrgangs in Österreich.
Bei den zukünftigen Versorgungsmodellen stehen zum einen der selbstbestimmte Patient im Zentrum, zum anderen die personalisierte Medizin.
Im ersten Beitrag erfolgt neben der Begriffsbestimmung Schlüsselkompetenz eine Auseinandersetzung mit den normativ gesetzten Systematiken des Europäischen (EQR) und des deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). Aus den Deskriptoren werden methodisch gelenkt die sog, Schlüsselqualifikationen für die Gesundheitsberufe herausgearbeitet und diese wiederum der Systematik des Kompetenzatlasses (Heyse/Erpenbeck/Ortmann 2010) zugeordnet. Am Beispiel zukünftiger Herausforderungen für die Humanmedizin wird dieser Ansatz ausgeformt.Die personalisierte Medizin, so der Autor, verändert auch die Anforderungen an die Kompetenzen der Gesundheitsfachberufe wobei hervorzuheben ist, dass Interprofessionalität im Handeln und in der Bildung als zentral herausgestellt wird.Die bildungspolitischen Herausforderungen werden am Wandel ausgewählter Berufsbilder vor dem Hintergrund der Gesundheitsreformen in Österreich sowie im internationalen Kontext, herausgearbeitet und zwar mit ihren Schwierigkeiten aber auch Möglichkeiten. In der Entwicklung von Fallkompetenzen steht im Zentrum die Biografie sensible Problemlösungsfähigkeit. Der Begründungszusammenhang leitet sich ab aus der alltäglichen Herausforderung die lebensweltlichen und biographischen Bezüge der einzelnen Patienten mit den institutionellen Anforderungen sowie den professionsspezifischen Handlungskonzepten in Einklang zu bringen. Der Beitrag zeigt Wege auf wie diese Problemlösungsfähigkeit erlernt werden kann und zwar in der Wechselwirkung zwischen der Problemhoheit des Individuums und der interaktionellen und institutionellen Deutung.Im letzten Beitrag dieses ersten Teils geht es um Patientensicherheit als interdisziplinäre Aufgabe. Dieser Beitrag setzt sich auseinander mit interdisziplinär einzusetzende Instrumente und Ausbildungskonzepte am Beispiel eines zweisemestrigen Universitätslehrgangs in Österreich.
Teil II
Ausgangspunkt im Handlungsfeld der Humanmedizin ist die Frage nach der Entwicklung einer professionellen Identität in der Ausbildung. Aufbauend auf empirischen Ergebnissen zu den Schlüsselkompetenzen wird das Konzept der Fassung mit den beiden Kompetenzbereichen Kommunikation und Reflexionsfähigkeit vorgestellt und anhand praktischer Bildungsarbeit veranschaulicht. Im folgenden Beitrag geht es um den Übergang von der Ausbildung in die Weiterbildung. Aufbauend auf empirischen Ergebnissen und den Daten aus der Analyse von Weiterbildungsordnungen wird am Beispiel einer Musterweiterbildungsordnung der Versuch unternommen verschiedene Kompetenzebenen für den allgemeinen Teil der Fachweiterbildung zu entwickeln , die dann in einem eigenen Kompetenzblock je nach fachlichem Schwerpunkt differenziert werden.Die solchermaßen entwickelten Schlüsselkompetenzen werden am Beispiel der Erwachsenenpsychiatrie, der Psychotherapie und für die Pharmazie vorgelegt. Für Studierende der Medizin liegt ebenfalls ein webbasiertes Instrument zum freiwilligen Selbstcheck des eigenen Kompetenzprofils vor. Inhalte und Funktionsweise und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten des Einsatzes in der Aus- und Weiterbildung werden dargestellt.
Ausgangspunkt im Handlungsfeld der Humanmedizin ist die Frage nach der Entwicklung einer professionellen Identität in der Ausbildung. Aufbauend auf empirischen Ergebnissen zu den Schlüsselkompetenzen wird das Konzept der Fassung mit den beiden Kompetenzbereichen Kommunikation und Reflexionsfähigkeit vorgestellt und anhand praktischer Bildungsarbeit veranschaulicht. Im folgenden Beitrag geht es um den Übergang von der Ausbildung in die Weiterbildung. Aufbauend auf empirischen Ergebnissen und den Daten aus der Analyse von Weiterbildungsordnungen wird am Beispiel einer Musterweiterbildungsordnung der Versuch unternommen verschiedene Kompetenzebenen für den allgemeinen Teil der Fachweiterbildung zu entwickeln , die dann in einem eigenen Kompetenzblock je nach fachlichem Schwerpunkt differenziert werden.Die solchermaßen entwickelten Schlüsselkompetenzen werden am Beispiel der Erwachsenenpsychiatrie, der Psychotherapie und für die Pharmazie vorgelegt. Für Studierende der Medizin liegt ebenfalls ein webbasiertes Instrument zum freiwilligen Selbstcheck des eigenen Kompetenzprofils vor. Inhalte und Funktionsweise und die sich daraus ergebenen Möglichkeiten des Einsatzes in der Aus- und Weiterbildung werden dargestellt.
Im Handlungsfeld der Therapieberufe werden für die Physiotherapie zwei kompetenzbasierte Bildungsprogramme dargestellt, einmal für die Schweiz und für Deutschland. Im Studienmodell aus der Schweiz werdenLösungen angeboten fürdie Problematik der Vernetzung von hochschulischen und praktischen Ausbildungsanteilen. In der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für den deutschen Raum wird nicht unterschieden zwischen fachschulischer Qualifizierung und hochschulischer, sondern generell die zukünftigen Anforderungen in diesem Feld begründet und situationsbezogen spezifiziert. Die BeiträgederErgotherapie stehen unter dem Motto: berufliche Handlungskompetenz gezielt entwickeln. Aufbauend auf eine zehnjährige Erfahrung in der Kompetenzentwicklung wird in diesem Beitrag ausgeführt wie diese Erkenntnisse im Studiengang Ergotherapie implementiert werden können. Reflexion als didaktische Methode zur Ausbildung von professionellem Handeln bestimmt die Entwicklung verschiedener didaktischen Settings und deren Nutzen im Ausbildungskontext. Anhand verschiedener Erprobungskontexte wird die Schlüsselkompetenz reflektiert zu handeln, vorgestellt.
Im Handlungsfeld Pflege beziehen sich die Beiträge auf die Ausbildungssituation in Österreich und der Schweiz. Das BestPractice Beispiel aus Deutschland stellt ein Qualifizierungsprojekt für Nachwuchsführungskräfte im klinischen Kontext vor. Hier geht es um Kompetenzentwicklungin der Mitarbeiterbindung. Die Ergebnisse werden anhand praktischer Erfahrungen dargestellt und auch Vorschläge für die nachhaltige Sicherung eines solchen Projektes gemacht. Der zweite Beitrag aus Deutschland präsentiert Erfahrungen aus einem Integrationsprojekt mit südeuropäischen Pflegekräften in die Altenpflege. Der Auswahl der Pflegekräfte, Talente finden und matchen, orientiert sich an den Anforderungen einer Interkulturellen Kompetenz. Anhand von erzählten Fallgeschichten und vor dem Hintergrund der Kompetenzanforderungen werden die Ergebnisse bewertet.
Die beiden Beiträge aus Österreich favorisieren das ProblemBasedLearning(POL)um Schlüsselkompetenzen zu erwerben. Ergänzt wird dieses Verfahren durch ein Mentoringprogramm, um insbesondere persönliche und berufliche Kompetenzen in der Praxis zu stärken. Der Einsatz von POL im Studiengang Advanced Nurse Practice erfolgt mit dem Ziel über die so vermittelten Schlüsselkompetenzen eineBrücke zwischen Pflegestudium und Beruf zu bauen. Anhand konkreter Arbeitsschritte in der curricularen Entwicklung werden die Ergebnisse kritisch diskutiert. Um kommunikative Kompetenz geht es in den Studiengängen fürFachpersonen im Gesundheitswesen. Die entsprechenden Module sind berufsübergreifend konzipiert um interprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern. Anhand von simulierten Situationen, abgeleitet aus den Themen der jeweiligen Gesundheitsberufe, wird das Trainingsprogramm absolviert. Die Evaluation zeigt, dass sich der Erwerb kommunikativer Kompetenz im geschützten Rahmen bewährt hat. Gleichermaßen im geschützten Raum geht es um den Erwerb kompetenzbasiertenHandelns im interprofessionellen Team von Hebammen und Anästhesisten. In sog. Hybrid Simulationensollen am Beispiel geburtshilflicher und medizinischer Situationen die kommunikativen, zwischenmenschlichen undprofessionsbezogenen Aktivitäten verbessert werden.
Zur Qualitätssicherung werden sowohl im Studiengang für Hebammen als auch in den praktischen Ausbildungseinheiten kontinuierlich Kompetenzmessungen durch Befragung aller am Betreuungsprozess Beteiligten, durchgeführt. Den Studierenden dient das so erstellte individuelle Kompetenzprofil der Selbsteinschätzung zumStand der eigenen Entwicklung.Solchermaßen gewonnene berufsrelevante Kompetenzen werdendann in die curriculare Planung und Weiterentwicklung des Studiengangsaufgenommen um Schlüsselkompetenzen für dieses Berufsfeld zu extrahieren.
Teil III
Der erste Beitrag greift die Kompetenztriade Arzt: Patient und Medizinische Fachangestellte heraus. Der größte Teil des Textes legt die Schlüsselfunktionen der Einzelgruppen dar. Deren Zusammenwirken in der Arztpraxis und die dazu notwenigen Kompetenzen werden vor dem Hintergrund des Kompetenzatlasses diskutiert. Der menschliche Faktor im Interesse der Patientensicherheit bestimmt das HAD medical Verhaltenstraining zur interprofessionellen Zusammenarbeit. Anhandvielfältiger Erfahrungen und systematischer Evaluationenkommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass dieses Programm einer Anpassung an die neuen Entwicklungen innerhalb der Gesundheitsberufe bedarf und, dass die Patientenperspektive in diesen Prozess einzubinden ist. Gelungenes und Gekonntes externes Feedback soll Brücken zwischen den Gesundheitsberufen bauen um interprofessionelle Kompetenz einzuüben mit dem Ziel die Qualität in der Patientenversorgung zu verbessern. Eine umfassende Annäherung an den Erwerb interprofessioneller Kompetenz leisten zwei Beiträge. Zum einen ein weiterbildender Studiengang “Health Science and Leadership“ sowie eine theoretische und praktische Annäherung an das Thema, die sowohl aktuelle Erkenntnisse als auch weiterführende Entwicklungen aufzeigt. Beide Beiträge können auf Erfahrungen von interprofessionell besetzten Studiengruppen in der Erprobung gemeinsamer Studieneinheiten zum Erwerb von interprofessioneller Kompetenz verweisen.
Vergleicht man die Einzelbeiträge mit dem eingangsausgeführten Zielen dieser Publikation so kann sicher festgehalten werden, dass alle Beiträge dem Ziel folgen Verbesserungen vorzuschlagen für die jeweils identifizierte Problemlage und hier jeweils spezifische Wege wählen. Deutlich wird aber auch, dass der Anspruch „durch die eingefangene Breite generelle Entwicklungsstränge sichtbar zu machen, konkrete Kompetenzentwicklungen und deren Validierung und Zertifizierung anzuregen und laufende Gestaltungen öffentlich zu stärken und zu verallgemeinern“ (S: XIII), zum größten Teil vom Leser, von den Leserinnen selbst geleistet werden muss. Die Vielzahl und reichhaltigen Lösungen, curriculare und didaktischen Konzepte regen zum „Nachmachen“ an, wenn es gelingt, das Allgemeine im Spezifischen herauszuarbeiten. Wie ein roter Faden zieht sich aber durch alle Beispiele die Bedeutung der interprofessionellen Verständigung als eine Schlüsselkategorie um den zukünftigen Herausforderungen in der gesundheitlichen Versorgung zu begegnen.
Die vorliegende Publikation ist ein empfehlenswertes Nachschlagewerk für die Hände von Lehrenden und Gestaltern in der Aus- und Weiterbildung. In diesem Sinne greift das programmatische Motto „Keep Educating Yourself“!
Der erste Beitrag greift die Kompetenztriade Arzt: Patient und Medizinische Fachangestellte heraus. Der größte Teil des Textes legt die Schlüsselfunktionen der Einzelgruppen dar. Deren Zusammenwirken in der Arztpraxis und die dazu notwenigen Kompetenzen werden vor dem Hintergrund des Kompetenzatlasses diskutiert. Der menschliche Faktor im Interesse der Patientensicherheit bestimmt das HAD medical Verhaltenstraining zur interprofessionellen Zusammenarbeit. Anhandvielfältiger Erfahrungen und systematischer Evaluationenkommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass dieses Programm einer Anpassung an die neuen Entwicklungen innerhalb der Gesundheitsberufe bedarf und, dass die Patientenperspektive in diesen Prozess einzubinden ist. Gelungenes und Gekonntes externes Feedback soll Brücken zwischen den Gesundheitsberufen bauen um interprofessionelle Kompetenz einzuüben mit dem Ziel die Qualität in der Patientenversorgung zu verbessern. Eine umfassende Annäherung an den Erwerb interprofessioneller Kompetenz leisten zwei Beiträge. Zum einen ein weiterbildender Studiengang “Health Science and Leadership“ sowie eine theoretische und praktische Annäherung an das Thema, die sowohl aktuelle Erkenntnisse als auch weiterführende Entwicklungen aufzeigt. Beide Beiträge können auf Erfahrungen von interprofessionell besetzten Studiengruppen in der Erprobung gemeinsamer Studieneinheiten zum Erwerb von interprofessioneller Kompetenz verweisen.
Vergleicht man die Einzelbeiträge mit dem eingangsausgeführten Zielen dieser Publikation so kann sicher festgehalten werden, dass alle Beiträge dem Ziel folgen Verbesserungen vorzuschlagen für die jeweils identifizierte Problemlage und hier jeweils spezifische Wege wählen. Deutlich wird aber auch, dass der Anspruch „durch die eingefangene Breite generelle Entwicklungsstränge sichtbar zu machen, konkrete Kompetenzentwicklungen und deren Validierung und Zertifizierung anzuregen und laufende Gestaltungen öffentlich zu stärken und zu verallgemeinern“ (S: XIII), zum größten Teil vom Leser, von den Leserinnen selbst geleistet werden muss. Die Vielzahl und reichhaltigen Lösungen, curriculare und didaktischen Konzepte regen zum „Nachmachen“ an, wenn es gelingt, das Allgemeine im Spezifischen herauszuarbeiten. Wie ein roter Faden zieht sich aber durch alle Beispiele die Bedeutung der interprofessionellen Verständigung als eine Schlüsselkategorie um den zukünftigen Herausforderungen in der gesundheitlichen Versorgung zu begegnen.
Die vorliegende Publikation ist ein empfehlenswertes Nachschlagewerk für die Hände von Lehrenden und Gestaltern in der Aus- und Weiterbildung. In diesem Sinne greift das programmatische Motto „Keep Educating Yourself“!
Ein Rezension von Prof. Dr. Margot Sieger

