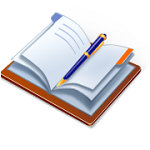
Pflege in Bewegung e.V. (Hrsg.)
bewegt euch!
Streitschrift für eine würdevolle Pflege in Deutschland
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2018, 112 S., 9,95 €, ISBN 978-3-86321-401-2
bewegt euch!
Streitschrift für eine würdevolle Pflege in Deutschland
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main, 2018, 112 S., 9,95 €, ISBN 978-3-86321-401-2
Jorde, A.
Kranke Pflege
Gemeinsam aus dem Notstand
Tropen, Stuttgart, 2019, 211 S., 17,00 €, ISBN 978-3-608-50384-5
Gemeinsam aus dem Notstand
Tropen, Stuttgart, 2019, 211 S., 17,00 €, ISBN 978-3-608-50384-5
Wendt, M.
Warum die Pflege in Not ist
Erfahrungsberichte eines Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers
Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin, 2019, 211 S., 9,99 €, ISBN 978-3-86265-772-8
Nachdem Pflegende und ihre Verbände jahrelang vergeblich vor einem sich abzeichnenden Notstand in den deutschen Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegediensten gewarnt hatten, ist das Thema in letzter Zeit verstärkt in Politik und Öffentlichkeit präsent. Dies schlägt sich auch in verschiedenen Neuerscheinungen nieder, die unterschiedlich relevante Beiträge zur Debatte liefern.
Pflege soll sich bewegen, ruft uns die vom Verein „Pflege in Bewegung“ herausgegebene Streitschrift im Kitteltaschenformat zu – aber wohin? Bei Lektüre der verschiedenen Beiträge, von denen keiner länger ist als zehn Seiten, wird die Antwort deutlich: Pflege muss sich zu einer öffentlich wahrnehmbaren eigenständigen Position bewegen. Sie muss transparent machen, was professionelle Pflege bedeutet und beinhaltet.
• Roger Konrad betont in seinem Beitrag die notwendige Fähigkeit zu „situativer Ethik“ in einer von Ressourcenknappheit geprägten Arbeitsumgebung, da die Pflegefachkraft die Fäden in der Hand hält und vielfältige in die Pflege involvierte Akteure koordinieren muss.
• Die Tochter einer Heimbewohnerin kommt zu Wort und berichtet von ihren umfangreichen Aktivitäten mit dem Ziel, die Missstände im Heim ihrer Mutter zu bekämpfen. Sie macht deutlich, dass auch in dieser Situation nicht notwendigerweise eine Gegnerschaft zu den Pflegenden entstehen muss, sondern sogar teilweise Bündnisse entstehen können.
• Ähnlich argumentiert die langjährige Heimleiterin Eva Trede-Kretzschmar: Alle müssten an ihrer Haltung arbeiten und miteinander handeln. Dabei sieht sie allerdings die Kostenträger in einer Schlüsselposition: Ohne Änderung der restriktiven Finanzierungspolitik werde es schwierig, ausreichend Pflegende mit der notwendigen „Begeisterung und Grundhaltung für den Beruf“ zu finden, die die zu Recht gesellschaftlich geforderte Pflegequalität erbringen können.
Der herausgebende Verein „Pflege in Bewegung“ fordert in dem Band einen Systemwechsel, wobei die Formulierung „Umstellung der Refinanzierung auf eine Pflegevollversicherung, mindestens aber eine echte Steuerfinanzierung“ etwas unentschieden scheint. Weiter wird eine bundesweit einheitliche Personalbemessung angestrebt, die auch die Qualitätsdefinition limitieren soll, sowie ein „Branchentarifvertrag Pflege“. Auf die Themen „Akademisierung“ und „Pflegekammer“ wird in den „12 Strategien für eine Highroad zur Pflege in Deutschland“ nicht eingegangen. Dagegen wird eine neue Prüfbehörde gefordert, die aus MDK und Heimaufsicht entstehen soll und auch „Eignung und Befähigung von Führungskräften“ bewerten soll. Konflikte mit benachbarten Professionen könnte die Forderung nach „Bedarfserhebung und Durchführung präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen“ als Vorbehaltsaufgabe der Pflege mit sich bringen.
Als ein Plädoyer, sich auf solche Konflikte durchaus einzulassen, kann man Christine Voglers Aufruf lesen, sich „Freiheit – Autonomie – Stolz“ auf die Fahnen zu schreiben und etwa die Praxis der „Abgabe der Inhalte an Psycholog*innen, Jurist*innen, Ärzt*innen“ in der Pflegebildung zu beenden.
Gleich zwei Beiträge thematisieren Gewalt in der Pflege und greifen auch die Politik dafür an, diese strukturell mit verschuldet zu haben. Warum ausgerechnet die beiden SPD-Politiker Ulla Schmidt (auf die inzwischen zwei FDP- und zwei CDU-Gesundheitsminister gefolgt sind) und Karl Lauterbach herausgegriffen werden, bleibt offen.
Alexander Jorde verteilt in seinem Buch die Verantwortung für die Missstände in der Pflege gleichmäßig auf die Regierungsparteien der vergangenen zwei Jahrzehnte. Als Hauptursache sieht er die Ökonomisierung des Gesundheitssystems und hier insbesondere die zu Lasten der Patienten wie der Pflegenden gehende Einführung des DRG-Systems. Der durch seine Fragen an die Bundeskanzlerin in der Wahlarena 2018 als 21jähriger Krankenpflege-Azubi bekannt gewordene Autor legt einen umfassenden Überblick zur prekären Situation und deren Entstehung sowie zu Lösungsansätzen vor, den er aus subjektiver Perspektive mit seinen eigenen Erfahrungen illustriert.
Jorde benennt, was an der öffentlichen Wahrnehmung nicht stimme: Einem Pflege-Azubi werde nicht deshalb „Wertschätzung entgegengebracht, weil man einen besonders anspruchsvollen und strukturell sehr komplexen Beruf erlernt, sondern weil er hart ist und man mit ‚ekligen‘ Dingen konfrontiert ist.“ Dabei ist er erfreulich uneitel, man nimmt ihm ab, dass er sich nicht in den Vordergrund spielen will: „Kaum ein Berufsstand würde es zulassen, dass jemand, der sich noch in der Ausbildung befindet, zum ‚Gesicht des Berufes‘ ernannt wird.“ Er fordert alle Pflegenden auf, sich in Gewerkschaften zu engagieren, und spricht sich klar für die Einrichtung von Pflegekammern aus.
Wie der Verein Pflege in Bewegung denkt auch Jorde über die Grenzen des Systems hinaus und postuliert, es „sollte sich nicht der Mensch dem System, sondern das System dem Menschen anpassen. Die Würde des Einzelnen steht über den Interessen der Allgemeinheit. Das zu verteidigen ist unsere Aufgabe als professionell Pflegende.“
Seine konkreten Lösungsvorschläge sind allerdings eher sozialdemokratische Reformpolitik: Jorde mahnt an, die im Koalitionsvertrag angekündigten Personaluntergrenzen einzuführen und langfristig die PPR zu reaktivieren. Er stellt Pflichtversicherungs- und Beitragsbemessungsgrenzen in Frage und kritisiert, dass die Pflege im Gemeinsamen Bundesausschuss nicht vertreten ist. Auch Jorde fordert eine Aufwertung der Pflege, um ausreichend Nachwuchs zu begeistern sowie ein Verbleiben im Beruf attraktiver zu machen. Schließlich spricht er sich dafür aus, dass private Unternehmen „ihr Handeln an moralischen Prinzipien ausrichten“, anstatt sich auf maximale Rendite auszurichten.
Jorde führt funktionierende Beispiele aus anderen Ländern wie etwa das ambulante Buurtzorg-Pflegesystem in den Niederlanden an, das er fundiert recherchiert und gut lesbar darstellt. Dieses Lob gilt für das gesamte Buch: Die Sprache ist lebhaft, und trotz fast 200 Fußnoten, für die man zum Ende blättern muss, sind Jordes Ausführungen spannend zu lesen. Jorde bringt viele Gedanken überraschend klar und analytisch auf den Punkt. Er nennt einerseits die wichtigsten Studien und die notwendigen Zahlen, zum anderen bietet er einen sehr schlüssigen subjektiven Blick auf die krank machenden Arbeitsbedingungen. Kritisch anzumerken ist hier einzig, dass entsprechend seiner persönlichen Perspektive das Buch fast ausschließlich von den Zuständen in der Krankenhauspflege handelt. Das ist legitim, geht aber aus Titel und Klappentext nicht deutlich hervor.
Das Buch richtet sich an ein breites Publikum: Gerade die pflegefremde Öffentlichkeit erhält Einblick in die Thematik des Pflegenotstands in deutschen Kliniken. Für Pflegende und insbesondere Auszubildende ist es ein Ansporn, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Lösungen man selbst für umsetzbar hält – und sich für deren Realisierung zu engagieren.
Ebenfalls einen Erfahrungsbericht hat der 1987 geborene Maximilian Wendt vorgelegt, der allerdings im Gegensatz zu Jorde die Anonymität wählt: Der Name sei aufgrund der „Brisanz“ seiner Schilderungen ein Pseudonym. Gleichwohl enthält das Buch zwei Fotos von ihm, und wir erfahren detailliert die Stationen seiner beruflichen Karriere von Zivildienst und Ausbildung (15 Kapitel sind nach den Einsätzen benannt) über Erfahrungen in der ambulanten Krankenpflege bis zur Pflegedienstleitung in der psychosomatischen Rehabilitation, von wo aus er mit 30 Jahren aus der Pflege ausstieg.
Die Erzählung des eigenen Werdegangs steht hier deutlich im Vordergrund, anstatt wie bei den anderen beiden Büchern der Veranschaulichung einer gesellschaftspolitischen Problemstellung zu dienen. Die Personalknappheit führt Wendt auf den demografischen Wandel und das negative Image der Pflege zurück. Eine genauere Analyse nimmt er jedoch nicht vor: Ob die mangelnde Attraktivität des Berufs auf strukturelle Mängel zurückzuführen sei oder es „einige wenige schwarze Schafe sind, die die Pflege in Verruf bringen, ist hier irrelevant, denn die Negativwirkung ist da.“
Die einzelnen Situationen, die schließlich zu Wendts Rückzug aus der Pflege führen, sind sehr kleinteilig beschrieben, allerdings so isoliert, dass die allgemeine Arbeitsüberlastung mehr postuliert als belegt wird. Hinzu kommt, dass viele der von Wendt skandalisierend dargestellten Ereignisse eher auf eine etwas empfindliche Disposition des Autors schließen lassen als auf generalisierbare Missstände. Ob Nachtdienste oder Arbeitswege über 15 Minuten, vieles ist dem Autor eine Zumutung. Er beklagt sich über sommerliche Wärme („genau meins, tropische Temperaturen, bei denen ich ohnehin schon eingehe und dabei noch arbeiten muss“) und hadert mit der Neonatologie: „Recht schnell merke ich, dass Kleinkinder nicht mein Steckenpferd werden, Kommunikation erfolgt zumeist nonverbal, es wird viel geschrien“.
Manche Beobachtungen sind für jeden, der etwas Einblick hat, auch schlicht falsch in ihrer allgemeingültigen Formulierung, etwa dass „in der Pflege generell eine sehr starke Hierarchie greift, fast schon militärisch ist die Stationsleitung, der Kommandeur“. Auch fachliche Details sind gelegentlich unzutreffend, so verwechselt der Autor etwa das Arbeitszeit- mit dem Arbeitsschutzgesetz. Quellen werden nicht angeführt, Wendt berichtet ausschließlich aus seinem Erfahrungsschatz.
Bestehende Lösungsstrategien wie die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte oder Pflegestellenprogramme werden von Wendt pauschal abgelehnt. Die generalistische Ausbildung betrachtet er ausschließlich als Abwertung: „Ich frage Sie, wer befürwortet, dass die fachliche Qualifikation eines so wichtigen Berufsbildes heruntergeschraubt wird?! Lediglich Politik und Wirtschaft befürworten das Herunterschrauben von beruflicher Qualifikation in einem derart anspruchsvollen Beruf“. Positionen der Pflegeverbände kommen in dem Buch nicht vor.
Als einzigen Ausweg, „dieses kaputte System“ zu heilen, sieht Wendt eine Abkehr von der Orientierung an der Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Die Gedanken hierzu sind nachvollziehbar, jedoch nur oberflächlich ausgeführt („solange das Geld im Mittelpunkt steht, wird es keine Verbesserung der Situation für die Mitarbeiter in der Pflege geben“); als Beleg für die Überlegenheit öffentlicher über privatwirtschaftliche Eigentumsstrukturen führt Wendt lediglich die klinische Berufserfahrung seiner Mutter an.
Für Fachleute enthält das Buch somit nichts Neues, für Laien ist die Perspektive zu individualistisch, um daraus wirkliche Erkenntnisse zu ziehen. Am ehesten ist es für angehende Auszubildende geeignet, die sich einen Insider-Blick verschaffen wollen über die ersten Jahre im Beruf und insbesondere den Ablauf der Ausbildung, der bei aller subjektiven Färbung sehr detailliert wiedergegeben ist. Wenn auch an manchen Stellen leicht unbeholfen formuliert, wirkt das Geschriebene authentisch und ist flüssig zu lesen.
So heterogen die drei Veröffentlichungen sind, lässt sich doch festhalten: In der Pflege ist vieles in Bewegung gekommen; wer auf Fehlentwicklungen hinweist, ist kein einsamer Rufer mehr. Damit die eigenständige Perspektive der Pflege als Profession öffentlich wahrgenommen wird, scheint es jedoch noch einiger Reflexion, Positionsentwicklung und Organisierung der Pflegenden selbst zu bedürfen.
Eine Rezension von Martin Braun

